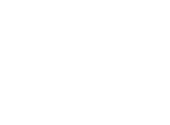Pressemeldung der Landeshauptstadt Hannover
- 16.09.2021
-

-

- Städtische Galerie KUBUS, Galerie vom Zufall und vom Glück, Städtische Galerie Lehrte und die Region Hannover im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge
„Malerei ff.“ im September und Oktober in vier Galerien in der Stadt und der Region
MALEREI ff.
Eduardo Flores Abad, Nina Aeberhard, Franz Betz, Sebastian Biskup, Constanze Böhm, Maja Clas, Hauke Johanna Gerdes, Anette Haas, Stefan Lang, Andreas Linke, Maximilian Neumann, Anne Nissen, Gaby Taplick, Antje Smollich, Christina Stolz
In Weiterführung des kooperativen Projektes „Malerei“ aus 2019 haben sich für 2021 erneut vier Ausstellungshäuser aus Hannover und der Region zusammengefunden: Die Galerie vom Zufall und vom Glück, die Städtische Galerie KUBUS, die Städtische Galerie Lehrte sowie die Region Hannover im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.
Diese zweite Ausstellung zum Stellenwert der Malerei in der zeitgenössischen Kunst der Region Hannover richtet den Fokus auf die Erweiterung der Malerei in andere Medien hinein, auf Positionen, die weniger direkt mit Malerei arbeiten, aber eine malerische Herangehensweise zeigen. Zu sehen sind Arbeiten, die so etwas wie eine „malerische DNA“ oder ein malerisches Denken vereint, von Zeichnung, Fotografie und Film über digitale Medien bis hin zu installativen und architekturbezogenen Arbeiten.
Kurator*innen der Ausstellung: Jennifer Bork (Region Hannover, Schloss Landestrost), Julienne Franke (Städtische Galerie Lehrte), Anne Prenzler (Städtische Galerie KUBUS) und Giso Westing (Galerie vom Zufall und vom Glück).
Zu den einzelnen Ausstellungen
Eröffnung: Freitag, 17. September 2021, 19 Uhr
Städtische Galerie Lehrte
Maja Clas, Andreas Linke, Maximilian Neumann
18. September. bis 21. November 2021Maja Clas beschäftigt sich mit dem Thema Raum mittels der Malerei und Collage. Beim Malen nutzt die Künstlerin oft Papier als Untergrund, das flach auf dem Boden oder einem Tisch liegt, da sie die Farbe sehr flüssig aufträgt und keine unwillkürlichen Verlaufsspuren entstehen sollen. Der erste Auftrag ist entscheidend, Übermalungen finden nicht statt, da sie die Wirkung verändern würden. Die Wahl des Farbtons und des Bildformats sind bei der reduzierten Arbeitsweise eminent wichtig.
Für die Collagen verwendet die Künstlerin bunte Papiere und Druckerzeugnisse unterschiedlicher Herkunft, aber auch selbst bemaltes Papier. Gebrauchsspuren im Papier wie Faltungen und Knicke sind sowohl beim Trägerpapier als auch den aufgeklebten Elementen Teil der Arbeit. Allerdings werden Schrift oder erkennbare Abbildungen vermieden, stattdessen dominieren einfache geometrische, seltener organische Formen. Das Papier wird nicht in Schichten übereinander geklebt und das Blatt auch nicht vollständig beklebt, sondern die frei bleibende Grundfläche ist wichtiger Teil der Gestaltung. In den Collagen finden sich mitunter auch malerische und zeichnerische Eingriffe.
Die Papierarbeiten werden selten gerahmt, sondern unmittelbar auf der Wand präsentiert. Dadurch befinden sie sich auf der gleichen Ebene wie die Wand und der Raum. Statt eines Objekts wird der flächige Charakter der Arbeit bewahrt und der Eindruck einer Kostbarkeit vermieden, die sorgfältig hinter Glas im Rahmen geschützt werden muss. Das Werk wird Teil der alltäglichen Umgebung, die dadurch eine veränderte Wahrnehmung erfährt.Andreas Linke hat dieses Jahr seinen Abschluss als Meisterschüler an der HBK Braunschweig gemacht. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Malerei lässt sich bereits an den in der Ausstellung gezeigten Werken ablesen. Die Frage nach dem malerischen Gestus, dem genialen Pinselstrich führte ihn zunächst zu einer expressiven Malweise. Diese wurde durch konzeptionelle, teils mathematische Bildgestaltungen erweitert, die sich in grafischen Mustern ausdrücken, deren farbliche Gestaltung jedoch weiterhin intuitiv erfolgen kann. Eine Kombination von Musterflächen und gestischem Farbauftrag ist ebenso möglich wie eine einzelne geometrische Form, die in einem Farbraum oder einer Farbfläche schwebt. Die Reduktion kann so weit gehen, dass eine einzelne Farbe als Fläche zum Bildgegenstand wird. Manche Bildgegenstände scheinen Schatten zu werfen, wodurch mehrerer Bildebenen entstehen ebenso wie durch Brechungen und Irritationen im Farbauftrag. Die Farbigkeit selbst reicht von leuchtend intensiv bis zu zurückhaltend und gedeckt.
Oft verwendet der Künstler gefundenes Material als Bildträger wie Sperrholzreste, Tischplatten oder Türen, die eigene Bildformate und Oberflächenstrukturen mitbringen. Das Material lässt die Bilder teils zu Objekten im Raum werden. Auch inhaltlich setzt sich der Künstler mit der Raumwirkung auseinander, allerdings über Farbe und Form, Struktur und Rhythmus und weniger durch perspektivische Verkürzungen. Die Arbeiten von Andreas Linke zeichnen sich durch Autonomie und eine Konzentration auf malerische Frage aus. Der Bildgegenstand bleibt unabhängig von Bezügen zu äußeren Objekten und stellt dennoch eine Zwiesprache mit seiner Umgebung her.Maximilian Neumann präsentiert eine Reihe von Arbeiten auf Papier, die das Format eines DIN A 4 Blattes nicht überschreiten. Die Malerei entsteht in einem schnellen gestischen Prozess, der an asiatische Tuschemalerei erinnert, für die sich der Künstler durchaus interessiert. Allerdings sind die hier präsentierten Arbeiten mit flüssiger Ölfarbe ausgeführt, teils in pastoser Manier. Der gestische Auftrag führt zu einer abstrakten, verkürzten Bildsprache, ohne auf Details einzugehen. Dennoch entstehen die Arbeiten an einem konkreten Ort, der in der Signatur genannt wird, oft direkt in der Natur, ohne eine klassische Landschaftsdarstellung mit Horizont und Räumlichkeit anzustreben. Stattdessen werden einzelne Naturformen in den Fokus gerückt oder größere Zusammenhänge dargestellt, wobei der Bezug zum Ursprungsmotiv nur noch zu erahnen ist. Die Farbigkeit ist ausdrucksstark und bedeckt das Papier nicht vollständig, so dass ein skizzenhafter Eindruck entsteht.
Mit dem Malen eines Bildes endet für Max Neumann die künstlerische Arbeit noch lange nicht. Sondern nun beginnt der zweite ebenso wichtige Teil seines Werks, die Präsentationsform. Die Bilder werden in eigens von ihm gefertigten Passepartouts eingefügt, die mit Buchbinderleinen bezogen sind. Dabei kommen leuchtende Farben als Bilduntergrund zum Einsatz, die je nach Bildserie variieren. Die Blätter werden nicht einzeln gerahmt, sondern in großformatigen Rahmen sind mehrere Werke leicht vertieft in die textile Oberfläche eingebettet. So entsteht ein neues Gesamtbild, mehrere Rahmen mit derselben Stofffarbe bilden eine Serie.
Die Rahmen hängen nicht an der Wand, sondern werden als Objekt im Raum präsentiert. Sie liegen auf vier aus Ton gebrannten Sockeln, die circa 40 cm hoch sind. Diese Präsentationsform verändert die Betrachtungsweise, statt eines Gegenübers fällt der Blick nach unten, wie auf einen niedrigen Tisch oder in eine Vitrine. Erst mit der jeweiligen Präsentationsform, deren zeitaufwendige Herstellung im Kontrast zum schnellen malerischen Gestus steht, ist der malerische Prozess bei Max Neumann zum Abschluss gekommen.Eröffnung: Samstag, 18. September 2021, 18 Uhr
Schloss Landestrost
Franz Betz, Sebastian Biskup, Hauke Johanna Gerdes, Stefan Lang, Anne Nissen
19. September bis 24. Oktober 2021Die Ausstellung im Schloss Landestrost vereint Positionen, denen eine Übersetzung malerischer Ansätze in technische Medien, wie Film, künstliche Intelligenz, Farberkennungs- oder Animations-Software zugrunde liegt. Die Ergebnisse und die inhaltlichen Ansätze der einzelnen Positionen sind sehr vielfältig, die in den Arbeiten stattfindenden Transformationsprozesse entfalten zum Teil eine stark absorbierende Wirkung.
Franz Betz zeigt die Arbeit „fern von nah“, die in Kooperation mit Birte Hölscher und Masha Kashyna (Klang) entstanden ist. Die gezeigten Bilder basieren auf einer künstlichen Intelligenz, die durch „machine learning“ trainiert wurde, Bilder mit malerischen Eigenschaften selbstständig zu erzeugen. Grundlage sind Bilder von isländischen Webcams, die im Schloss Landestrost auf einen Fadenvorhang projiziert und damit deutlich abstrahiert werden. Dennoch identifiziert der/die Betrachter*in aufgrund seines/ihres eigenen Bildgedächtnisses das gezeigte Material noch als Landschaft und kann teilweise Bezüge zu bekannten Landschaftsgemälden wie beispielsweise von Claude Monet herstellen. Das menschliche Netzwerk aus neuronalen Verknüpfungen interagiert dabei mit dem künstlichen Netzwerk.
Sebastian Biskups Animation erzeugt eine Wirkung, die man zunächst als bewegte Farbfeldmalerei beschreiben könnte. Tatsächlich sind es formale Reduktionen von Werbeunterbrechungen eines Samstagabendspielfilms, Biskup spaltet die einzelnen Bilder in ihre kompositorischen Bestandteile (Farbe, Form und zeitlichen Ablauf) auf und lässt diese in der Animation, durch die Erzeugung von Zwischenbildern (Tweening), in eine flüssige Bewegung übergehen. Hinterfragt wird der Raum, der beim Fernsehen als gemeint angenommen wird. Beim Betrachten der in ungegenständliche Grafiken übersetzten Fernsehbilder, setzt man automatisch bestimmte Farben und Formen in einen räumlichen Kontext. Helle Farben scheinen näher, dunkle Farben weiter entfernt. Im Verlauf der Animation werden solche Räumlichkeiten von den Betrachter*innen in deren Verständnis des Gesehenen gedanklich aufgebaut, um dann im nächsten Moment zu kollabieren und sich neu zu strukturieren. Sebastian Biskup arbeitet zumeist mit vorherbestimmten Formen und anderen Parametern, die künstlich erzeugt werden: „Für mich erweist sich, angesichts einer Alltagswelt in der nichts und niemand unästhetisiert /undesignt in die Öffentlichkeit entlassen wird eine eigenständige Bildsprache als nahezu überflüssig. Das visuelle Rohmaterial, das uns umgibt, liefert mir eine Basis, den Blick des Betrachters zurückzuführen auf das Ursprüngliche im Mediendschungel.“
Hauke Johanna Gerdes kommt ursprünglich aus der Malerei und wandte sich der Fotografie und dem Film zu. Im Schloss Landestrost zeigt sie in einem eigens erstellten Projektionssaal drei Filme (Evaporation, Lascaux, Verwandlung), die in Zusammenarbeit mit Abel Boukich, Rafael Vogel und Klaus Weingarten sowie dem Sector 16-Filmlabor entstanden sind. Hauke Johanna Gerdes versteht sich in der Tradition der Maler, die in den 1920er Jahren dem Film neue, künstlerische Impulse gaben. Die Konzentration liegt in ihren Filmarbeiten auf dem analogen 16 mm-Filmmaterial, welches oftmals experimenteller Bearbeitung im Labor unterworfen wurde. In „Evaporation“ etwa löst sich die Filmschicht eines Zelluloid-Films durch chemische Einwirkungen auf das Trägermaterial für acht Sekunden auf. Auf diese Weise entstehen Zwischenbilder der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das Ausgangsmaterial besteht aus Found Footage eines Lehrfilms über Seidenbau. Der Titel bezeichnet den Übergang von einem flüssigen in einen gasförmigen Aggregatzustand.
Stefan Langs Arbeiten haben sich aus dem Nachdenken über die Farbe im klassischen Tafelbild entwickelt. Seine pastosen Gemälde bilden den Ausgangspunkt einer Erforschung der räumlichen und zeitlichen Dimension von Farbe, sowie deren Interaktion mit dem Klang. Lang greift dabei auch auf Software zurück die ursprünglich für blinde Personen entwickelt wurde, um Farben in Sprachinformation zu übersetzen.
Anne Nissen zeigt mit „Laminar“ eine Videoinstallation auf zwei 4K-Monitoren. Dort wird synchron die Ausbreitung farbiger Tuschetropfen in Richtung der Bildmitte eines quadratischen Bildraumes gezeigt. Die schwerelos erscheinende Bewegung und die sich langsam überlagernden, feinen Linien bilden Formen, die ähnlich eines Mandalas eine fast meditative Wirkung entfalten.
Eröffnung: Sonntag, 19. September 2021, 12 bis 18 Uhr
Städtische Galerie KUBUS
Constanze Böhm, Gaby Taplick, Christina Stolz
19. September bis 31. Oktober 2021In der Städtischen Galerie KUBUS liegt der Schwerpunkt auf Arbeiten, die die Malerei in bildhauerische Fragestellungen sowie installative Konstruktionen und Architekturen weiterdenkt.
Constanze Böhm hat einen ortbezogenen Raum für die Städtische Galerie entwickelt, der den Lichteinfall durch die im KUBUS charakteristischen Oberlichter aufgreift und „einfängt“. Ihre dreidimensionale, begehbare Architektur geht ganz im malerischen Sinne aus von Fläche und Farbe. Farbe, die von einer irritierenden Zartheit ist. Constanze Böhm schafft einen Raum im Raum für das Licht und für den Menschen, der zugleich eine kalkulierte Herausforderung und Verunsicherung für unsere Wahrnehmung darstellt. Eine Fortführung findet diese Installation in einer Wandgestaltung, die den Lichtschein wiederum in eine Malerei übersetzt, deren Farbigkeit geradezu ephemer ist. Hinzu treten im Gesamtbild eine Reihe neuer Arbeiten aus Stoffresten, montiert auf zart gestrichene Holzplatten, die als poetisch anmutende „übrig, gebliebene“ Formen eine erstaunliche formale Stärke entwickeln; sowie zahlreiche, kleine emblematische Arbeiten, die grundsätzliche Fragen von Malerei diskutieren. Constanze Böhm schafft mit dieser Installation ein Gesamtkunstwerk, das die Mittel der Malerei einsetzt, um physische und psychische Dimensionen von Raum und Farbe auszuloten.
Im Treppenhaus des KUBUS hat Gaby Taplick aus recycelten Möbeln ein fassaden-füllendes Bild geschaffen, das mit einer gewissen Strenge wie eine konstruktivistische Farbfeldmalerei in gedeckten Tönen daherkommt. Irritierend gut fügt sich diese Installation in den denkmalgeschützen Raum ein und ermöglicht dabei zugleich eine ganz neue Wahrnehmung der vorhandenen Architektur. Im Obergeschoss hat die Künstlerin zudem eine Landschaft aus japanischen „Berggeistern“ aufgebaut, die mit verschiedenen Kimono-Stoffen bezogen sind. Eine Installation von großer Poesie, die bei aller Farbigkeit eine große Ruhe und Konzentration erzeugt. Gaby Taplick gelingt es mit ihren Installationen klare Bilder zu schaffen, die zugleich von der Lust am Spiel zeugen und den Materialien und Räumen gänzlich neue Qualitäten entlocken.
Christina Stolz lädt die Besucher*innen in einen bühnenhaften Aufbau ein, in dem farbige Stoffe, Stoffbilder, Zeichnungen, Objekte aus Keramik und Wandgestaltungen auftreten. Displays, die an Tischplatten erinnern oder an Ausstellungspräsentationen aus musealen Zusammenhängen, präsentieren einen Schwarm von 366 kleinen Schalen und andere, sorgsam komponierte Gefäße. An vielen Stellen finden sich formale und farbliche Korrespondenzen – sodass die einzelnen Bestandteile der Installation wie Akteur*innen auf einer interieurhaften Bühne ganz eigene Dialoge entwickeln und regelrechte „Gespräche“ führen. Christina Stolz gelingt es dabei, uns Betrachter*innen – mit einer beiläufigen Unausweichlichkeit – einzubinden in eine malerische, theatrale Erzählung.
Auch untereinander interagieren die drei künstlerischen Positionen, indem sie ähnliche Materialien und Strategien einsetzen, wenn sie malerische Fragen in den Raum hineinerweitern – und dabei im Ergebnis aber zu sehr unterschiedlichen Fragen und Antworten finden.
Eröffnung: Sonntag, 19. September 2021, 12 bis 18 Uhr
Galerie vom Zufall und vom Glück
Eduardo Flores Abad, Nina Aeberhard, Maja Clas, Anette Haas, Antje Smollich
19. September bis 31. Oktober 2021Während wir in der Ausstellung vor zwei Jahren Bilder gezeigt haben, die sich im Zentrum der Malerei bewegten, zeigen wir nun Positionen, die am Rand der Malerei angesiedelt sind oder gar in anderen Techniken, wie Zeichnung, Collage und Assemblage ausgeführt sind. Es geht um Konzeptionen, die man als das malerische Denken bezeichnen könnte, eine radikale Einschränkung als Abstraktion im Sinne eines Verzichts: Diese Bilder stellen nichts dar, bilden nicht ab, sondern repräsentieren nur sich selbst in Farbe, Matereial und Oberflächenbeschaffenheit. Sie sind so gesehen, absolut – weil souverän im Ausdruck, da sie nur sich selbst ausdrücken wollen und keiner weiteren Inhalte oder von außen dazukommender Bedeutungen bedürfen.
Eduardo Flores Abad zeigt am Computer generierte Bilder, die nur aus Punkten und dazu gewählten Farben bestehen. Dazu hat er, den Gedanken seiner Bilder aufnehmend, eine etwa fünfminütige Sound-Komposition geschaffen: „Puntos y Formas“ besteht aus Pizzicato-Klängen auf der Violine und dem Klang von in Wasser fallenden Tropfen. Es sind Klangpunkte, die bearbeitet wurden durch elektronische Prozesse wie Granulierung, Spreizung und Amplitudenerweiterung, um eine Entwicklung am Material zu zeigen, die dem der Bilder entspricht. Die Dramaturgie aus Lockerung und Verdichtung wie Überlagerung wechselnder Bewegungen schafft einen Spannungsbogen.
In den Arbeiten von Nina Aeberhard artikuliert sich das malerische Denken in der Fotografie. Es sind Licht und Schatten als hell-dunkel Kontraste und die Graustufen, die in ihren Differenzen Dynamik im Bild wie auch im ganzen Ensemble der drei zusammengestellten Arbeiten erzeugen. Das sind minimalistische und ganz formale Überlegungen. Gerade, weil sie so formal sind, sind sie abstrakt.
Das Minimale ist das Maximale. Das ist kein Paradox, sondern die bildnerische Praxis von Anette Haas. Denkbar einfache Anordnungen werden mit einem hohen Aufwand von subtilem Auftrag der Farbe mit dem Zeichenstift, der Kreiden und Malfarben kleinschrittig entfaltet. Es geht um feinste farbliche Nuancen in der Oberfläche der Farbfelder wie der Beschaffenheit des Bildgrundes überhaupt.
Wie komme ich zu Bildern oder was macht ein Bild aus? Diese Frage treibt Maja Clas an. In einem langwierigen Prozess von schrittweiser Addition entstehen die Papierarbeiten; es wird angefügt und wieder weggenommen, bis eine die Künstlerin befriedigende Zwiesprache aller Elemente im Bild stattfindet. Es ist eine ausgefeilte Arbeit am Poetischen, um die Leichtigkeit, Freiheit und Frische der Improvisation zu erlangen, die die Bilder ausstrahlen.
Antje Smollich verwendet Materialien, die Gitterstruktur aufweisen für ihre Bildkonstruktionen. Durch Überlagerungen farblich unterschiedlicher Texturen entstehen transparente Mischfarben. Dazu kommt noch der Oberflächenglanz und die Art der jeweiligen Flechtung, dass zudem auch changierende Effekte auftreten wie bei Hologrammen. Man sieht auf die Flächen und gleichzeitig durch sie hindurch, was eine verwirrende Fensterwirkung hervorruft.
Was hier kurz zu den Positionen gesagt wird, gilt natürlich nicht nur für die jeweils Einzelne, sondern in gewisser Weise für alle. Schönheit in der Ruhe, der Einfachheit wie Schlichtheit, zieht sich durch die Ausstellung. Die Frage nach dem Bild, nach der Oberfläche, die Idee, das Material zu verwandeln, es neu erscheinen zu lassen und das Interesse an Reduktion als Verdichtung überkreuzt sich in dieser Ausstellung und ist die gedankliche Klammer. So entstehen zwischen den Arbeiten immer wieder überraschende Übergänge und Korrespondenzen.